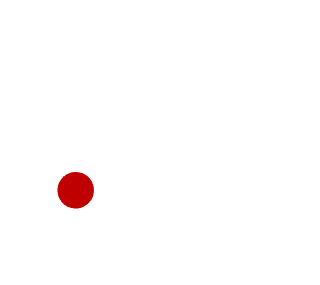An diesem Mittag ist Friedrich Merz dorthin zurückgekehrt, wo er vor einer Woche einen brutalen Nervenkitzel durchlitt: In den Bundestag, wo er im ersten Wahlgang durchgefallen war und erst im zweiten zum Bundeskanzler gewählt wurde. Doch das ist Vergangenheit, nun steht sein erster Termin im höchsten deutschen Parlament als Kanzler auf dem Programm: die erste Regierungserklärung. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hatte die Rede als die „vielleicht wichtigste des Jahres“ bezeichnet. Das wirkte ein bisschen wie ein Fußballtrainer, für den das jeweils nächste Spiel immer das wichtigste ist – aber die Spannung und Aufmerksamkeit waren tatsächlich groß.
Seine erste Regierungserklärung hielt der Bundeskanzler in ruhigem, sachlichem Duktus. Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge sprach anschließend von „länglichem Vorlesen des Koalitionsvertrages“, doch in der Rede steckte mehr, wenn auch inhaltlich tatsächlich wenig Neues zu hören war. Zwischentöne, wie der ausdrückliche Dank an seinen Vorgänger Olaf Scholz, waren wichtig. Beide waren nie miteinander warm geworden, umso mehr war das eine starke Geste unter Demokraten.
Drei Punkte stachen aus der ersten Regierungserklärung des Bundeskanzlers heraus.
1. Die Außenpolitik, insbesondere die Ukraine, hat für ihn Vorrang
„In der Ukraine steht nicht weniger als die Friedensordnung unseres ganzen Kontinents auf dem Spiel“, sagte Merz. Das von Russland angegriffene Land war das erste große Thema der Rede. Russland benannte er klar als Aggressor, der längst auch Deutschland und Europa ins Visier genommen habe. Das zeige sich in ständigen Cyberangriffen sowie in der Spionage bis zu Morden in europäischen Städten, auch in Berlin.
Deutschland sei nicht Kriegspartei und wolle es auch nicht werden, so der Kanzler. Aber Deutschland sei auch „kein unbeteiligter Dritter“. Dabei betonte er, dass Deutschland gemeinsam mit den anderen Staaten Europas und den USA handeln werde. Selbstverständlichkeiten für einen deutschen Bundeskanzler – auch Scholz hätte das so gesagt. Allerdings galt sein Verhältnis zu Frankreichs Präsident Emmanuel Macron als schwierig.
Von der Ukraine kam Merz zur Bundeswehr. Die solle die „stärkste konventionelle Armee Europas werden“, sagte der Kanzler. Ein Satz, der zwar nicht überraschte, so deutlich aber bisher nicht zu hören gewesen war. „Das ist dem bevölkerungsreichsten und wirtschaftsstärksten Land Europas angemessen“, sagte Merz. Das forderten die „Partner und Freunde“. Ein heikler Moment in der Rede: Merz hatte Wochen zuvor Teile der Union gegen sich aufgebracht, weil er gemeinsam mit der SPD die Schuldenbremse für Verteidigung weitgehend ausgesetzt hatte. Bei Aufrüstung und Instandsetzung der deutschen Armee folge er einem Grundsatz, sagte Merz: „Wir wollen uns verteidigen können, damit wir uns nicht verteidigen müssen.“
2. Innenpolitische Priorität hat die Wirtschaft
Merz machte schon damit Wahlkampf, vor allem für Wirtschaftswachstum sorgen zu wollen. Mit Abschreibungsmöglichkeiten für Konzerne, Senkung der Körperschaftssteuer, Aktivrente und vor allem Bürokratieabbau will er das erreichen. „Unsere Wirtschaft ist in großen Teilen immer noch wettbewerbsfähig“, sagte Merz. Aber die Rahmenbedingungen seien es nicht mehr. „Immer mehr Regulierung, erdrückende Bürokratie, marode Infrastruktur, eine teure Energieversorgung und vergleichsweise hohe Steuern und Abgaben. Das hemmt seit Jahren das Potenzial, das in unserer Wirtschaft steckt.“
Dafür müsse Deutschland investieren. 150 Milliarden Euro seien dafür dieses Jahr vorgesehen. Möglich macht’s das neue Schuldenpaket namens Sondervermögen für Infrastruktur, das 500 Milliarden Euro über zwölf Jahre bereitstellt. Eine solche massive neue Schuldenaufnahme hatte Merz im Wahlkampf noch weitgehend ausgeschlossen. Auf die darauffolgende Kritik versuchte Merz nun mit „einem offenen Wort“ einzugehen. „Wir müssen mit diesen Möglichkeiten äußerst behutsam und vorsichtig umgehen“, forderte er. „Diese Schulden lösen Zinszahlungen aus und müssen auch wieder zurückgezahlt werden.“ Sie ließen sich nur rechtfertigen, wenn der Wert der Infrastruktur dauerhaft gesteigert werde.
3. Sozialpolitik ist wichtiger als Migration und Klimaschutz
Wenn man die Reihenfolge der Themen als Maßstab für ihre Bedeutung nimmt, rückt die Migrationsfrage dorthin, wo der Klimaschutz bereits ist: Eher ans Ende der Prioritätenliste. Bevor er darauf zu sprechen kam, widmete sich Merz ausgiebig sozialen Fragen. Merz bezeichnete einen Mindestlohn von 15 Euro als wünschenswert, dieser werde aber nicht per Gesetz festgeschrieben, versprach er. Wogegen die SPD, vorsichtig formuliert, vermutlich nichts einzuwenden hätte. In dem Thema steckt Konfliktstoff – ob das letzte Wort in dieser Frage gesprochen ist, wird sich zeigen müssen.
Merz bezeichnete die Wohnkosten als eine der wichtigsten sozialen Fragen, aber auch dieses Thema kam erst spät zur Sprache. Wohnraum müsse bezahlbar bleiben, forderte er und rief das Motto „Bauen, Bauen Bauen!“ aus. Auch mehr Sozialwohnungen sollten gebaut werden. Eine Zahl, wie viel Wohnungen pro Jahr entstehen sollten, nannte er aber nicht. Scholz hatte das getan und war an dem Ziel von 400.000 Wohnungen pro Jahr sang- und klanglos gescheitert.
Durchaus überraschend war, dass das Thema Migration erst zum Schluss der Rede kam. Im Wahlkampf hatte sie noch eine zentrale Rolle eingenommen. Dabei versprach Merz „mehr Zurückweisungen, mehr Steuerung, mehr Rückführungen.“ Deutschland halte sich an internationales Recht, so Merz. Was allerdings derzeit infrage gestellt wird. Auf welcher Grundlage kann Deutschland Asylbewerber zurückweisen? Nach Europarecht geht es nicht, zumindest nicht direkt an der Grenze, nach nationalem Recht allerdings schon.
Klimaschutz, vor vier Jahren noch eines der Top-Themen, kam bei Merz erwartungsgemäß nur unter „Ferner liefen“ vor. Die Klimaziele sollten eingehalten werden, gelobte er. Dabei will er aber lediglich auf den CO2-Preis setzen.
Merz sagte, er wolle die Stimmung im Land drehen. „Wir können alle Herausforderungen, ganz gleich wie groß sie auch sein mögen, aus eigener Kraft heraus bewältigen“, versprach er. „Ich möchte, dass Sie, die Bürgerinnen und Bürger, schon im Sommer spüren: Hier verändert sich etwas zum Guten, hier geht es jetzt voran“, sagte er. Das klingt nach wenig, ist es in Zeiten, in denen eine Krise nach der anderen über Deutschland hereinbricht, aber nicht.